Wie alles begann ...
20 Jahre Tag der BegegnungAus einer Protestaktion gegen ein umstrittenes Gerichtsurteil gegen Menschen mit Behinderungen wird Europas größtes Familienfest für Menschen mit und ohne Behinderung. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) erzählt die Geschichte des „Tags der Begegnung"
Wie alles begann ...
Das Landgericht Aachen weist die Klage zunächst ab. Es kann bei mehreren, auch nicht angekündigten Ortsterminen keine Lärmbelästigung feststellen. Darüber hinaus bestärkt das Gericht, dass Behindertenheime in Wohngebieten baurechtlich zulässig sind. Die Menschen seien somit kein „Störfaktor“ und ihre Lebensäußerungen müssten von der Nachbarschaft hingenommen werden.
Das akzeptiert der Kläger jedoch nicht. Er zieht vor das Oberlandesgericht (OLG) Köln und dort wird seiner Klage in Teilen Recht gegeben. Nach Einschätzung des Gerichts hätten die Laute der Menschen einen besonders hohen „Lästigkeitsfaktor“: Die Laute wären also nicht zu laut, sondern „fehlmoduliert“ und dadurch lästig. Das OLG verpflichtet den Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Einrichtung zu bestimmten Zeiten im Garten der Wohngruppe für Ruhe zu sorgen.
Vom Behindertenfest "Füreinander - Miteinander" zum Tag der Begegnung 2019
1998
1998

Der erste „Tag der Begegnung“ im Archäologischen Park in Xanten

Auszug aus der Presseeinladung vom 21. September 1998:
„Hunderte von Gruppen geistig-, sinnes- und körperbehinderter Menschen machen sich am Samstag, 26. September, auf den Weg nach Xanten: Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) lädt erstmals ein zu einem Fest der Begegnung, das dem zwanglosen Kontakt und dem Austausch zwischen Besuchern mit und ohne Behinderung dienen soll.“

1999
Behinderteneinrichtungen geben Einblicke in ihre Arbeit. Verbände vermitteln einen Überblick über ihre Angebote und Fachdienste zeigen, wie Menschen mit Behinderung geholfen werden kann.
Auch sportliche Auftritte wie der Rollstuhltanz gehören beim „Tag der Begegnung“ von Anfang an zum Programm.
2000 / 2001
2002
2002

Der damalige Bundespräsident Johannes Rau besucht den „Tag der Begegnung“ und macht das Fest damit bundesweit bekannt.

„Statt Ihnen eine Rede zu halten, möchte ich Ihnen nur eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Als ich ein ganz junger Abgeordneter war, und das war ich mal, da wurde ich Berichterstatter - so nannte man das - über das neue Schulpflichtgesetz.
In diesem Schulpflichtgesetz gab es einen Paragraph zehn, der beschäftigte sich, so nannte man das in der Amtssprache, mit der "Beschulung" Behinderter. Und ich hatte darüber zu reden, zu diskutieren, Übereinstimmung zwischen den Fraktionen zu suchen und ich entwickelte mich – so hoffe ich – in wenigen Monaten zum Spezialisten für Schulfragen bei Behinderten.
Dann geschah etwas ganz Merkwürdiges. Ein Kind kam auf mich zu, ein sogenanntes Contergankind, gab mir die an die Schulter angewachsene Hand und sagte: „Ich hab' mit Dir Geburtstag, wollen wir nicht zusammen feiern?“ Sie war sechs oder sieben Jahre. Da stellte ich auf einmal fest, wie hilflos ich war gegenüber dem ersten behinderten Menschen, der mich selber ansprach und der sich mit mir befreunden wollte.
Ich stellte fest: Das ganze Kartenhaus meiner theoretischen Erkenntnisse war weg. Ich wusste gar nicht, wie ich mich gegenüber diesem Kind verhalten sollte. Ich merkte auf einmal: Ich, der ich mich für nicht behindert hielt, ich war der Befangene und der Hilflose.“

2003
In der bis auf den letzten Platz besetzten Arena feiern viele Tausend Menschen mit und ohne Behinderung die Prinzen, den Topact des Tages.
2004
Mit einem „Klick“ auf die Audio-Datei am Ende dieser Seite erfahren Sie mehr über den „Tag der Begegnung“ 2004.
2005
Der Staffellauf findet in Anlehnung an den olympischen Fackellauf statt. Die Kinder und Jugendlichen sind mit Handbikes, Tandems, Rollschuhen, Skates oder zu Fuß unterwegs - jedes Kind macht so mit, wie es kann und will. Das gemeinsame Ziel ist der „Tag der Begegnung“.
2006
Zitat des DFB-Präsidenten Theo Zwanziger:
„Die Veranstaltung bietet ein beeindruckendes Spektrum des gemeinsamen sportlichen Miteinanders von uns Menschen mit und ohne Behinderung. Leistung kennt kein Handicap!“
Bei der Mitmach-Aktion „Hand drauf!“ können die Besucher*innen außerdem ihre Handabdrücke auf einem Stoffband hinterlassen, das als Band der Freundschaft und Solidarität vom Römerpark zum Xantener Stadion zum Fußballspiel gespannt wird. Daran entlang bildet sich um 17 Uhr eine Menschenkette als Zeichen für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung.
Mit einem „Klick“ auf die Audio-Datei am Ende dieser Seite erfahren Sie mehr über den „Tag der Begegnung“ 2006.
2007
Die „Peter Maffay Stiftung“ hat die Aufgabe, Kinder zu betreuen, die durch Gewalt, sexuellen Missbrauch im familiären Bereich oder schwere Krankheiten traumatisiert sind. Außerdem ist Peter Maffay Schirmherr der „Tabaluga Kinderstiftung“, die traumatisierte Kinder und Jugendliche stationär und ambulant betreut.
Anschließend steht Peter Maffay natürlich auch auf der Bühne und singt seinen Hit „Sonne in der Nacht".
2008 / 2009
2009 komponiert Klee einen Song für den „Tag der Begegnung“ und spielt ihn mit Kindern gemeinsam ein: „Wir leben zusammen, sind füreinander da. Wir halten zusammen. An jedem neuen Tag“, heißt es im Refrain.
Zitat der Klee-Sängerin Suzie Kerstgens:
„Es war ein unvergleichliches Erlebnis, wie schon an einem Tag das gemeinsame Musizieren und Singen Grenzen und Handicaps einfach überwindet."
2010
Das Motto lautet: Integration durch Kultur. Oft hat Kunst von Menschen mit Behinderung nicht den Stellenwert, wie die von Menschen ohne Handicap. Beim „Tag der Begegnung“ stellt der LVR diese Kunst in den Fokus und zeigt ihre Bedeutung und Ausdruckskraft. Von Malerei, Skulpturenbau, Tanz, Theater und Gesang über Grafiken ist alles dabei.
2013 / 2014
2015
Gemeinsam mit dem LVR wählt 2THEUNIVERSE drei Finalisten aus und besucht sie zum gemeinsamen Jammen in deren Proberäumen. Beim „Tag der Begegnung“ wird die Siegerband gekürt: Die Ottosingers stehen gemeinsam mit 2THEUNIVERSE auf der großen Bühne im Tanzbrunnen.
Schauen Sie sich die Videos der drei Finalisten an.
2017
Buchautor Samuel Koch übernimmt die Schirmherrschaft für den „Tag der Begegnung“.
Seit seinem Unfall im Jahr 2010 ist der ehemalige Sportartist querschnittgelähmt. Viele bewundern ihn für seinen Mut und seinen Ehrgeiz: Trotz seiner Verletzung baute er sich nach dem Schauspielstudium ein neues Leben als festes Ensemblemitglied des Staatstheaters Darmstadt auf. Zudem nutzt Samuel Koch seine Bekanntheit und macht sich für soziale Projekte wie die Initiative „Wings for Life“ oder die „Elfmeter-Stiftung“ stark – beide engagieren sich für Kinder und Jugendliche mit Rückenmarksverletzungen.
Zitat von Samuel Koch:
„Ich freue mich, dieses einzigartige Fest als Schirmherr zu unterstützen. Der „Tag der Begegnung“ trägt zum gesellschaftlichen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung bei – so wie ich es mir wünsche und es auch für selbstverständlich halte.“
20. Tag der Begegnung am 25. Mai 2019 von 11 bis 20 Uhr im Rheinpark Köln. Der LVR präsentiert den inklusiven Bühnenact SEIN - seit 2018 tourt diese Show der Begegnung durchs Rheinland..
20. Tag der Begegnung am 25. Mai 2019 von 11 bis 20 Uhr im Rheinpark Köln. Der LVR präsentiert den inklusiven Bühnenact SEIN - seit 2018 tourt diese Show der Begegnung durchs Rheinland..

Das große Jubiläumsfest

Neu im Jubiläumsjahr ist das Abendprogramm ab 18 Uhr mit den Pop Nights feat. Culcha Candela, Leslie Clio und Jochen Distelmeyer. Ebenfalls Teil des Abendprogramms ist Breakdancer REDO, der dem Publikum tänzerische Höchstleistungen bietet, während die blinde Singer-Songwriterin CassMae melancholische Töne anschlägt. Direkte, humorvolle Worte findet Ninia LaGrande in ihrer Doppelrolle als Poetry-Slammerin und Moderatorin. Comedian Tan Caglar bringt die Menschen als rollstuhlfahrender Türke und Wortkünstler zum Lachen.
Das Finale des „Tags der Begegnung“ ist gleichzeitig der Start des Sommerblut-Kulturfestivals 2019. Eröffnet wird das Fest von der Band Druckluft. Die 13 Musiker*innen setzen mit viel Brass und jeder Menge kölschem Lebensjeföhl die Gäste in Schwingung.
Schirmherren sind in diesem Jahr NRW-Landtagspräsident André Kuper und Schauspieler Samuel Koch. Ein interaktives Sportangebot des BRSNW mit vielen Stationen bereichert das Programm.
Das komplette Programm können Sie sich hier anschauen.

Abspann
Eine Frage zum SchlussWie geht es mit der Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Kreuzau nach dem Urteil weiter?

Mit dem Gerichtsurteil hat die Auflösung der Wohngruppe allerdings nichts zu tun. Hierfür sind schlicht baurechtliche Normen verantwortlich. Es handelt sich um ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Die Bewohner sind zum Teil in Doppelzimmern untergebracht und können die oberen Stockwerke nur über eine schmale Betontreppe erreichen. Das Haus ist für die Unterbringung von Menschen mit Behinderung langfristig nicht geeignet.
Porträt einer ehemaligen Nachbarin der Wohngruppe
Porträt einer ehemaligen Nachbarin der Wohngruppe

Vera Wilden war acht Jahre alt, als die sieben schwer behinderten Männer 1993 in das Haus auf der anderen Straßenseite einzogen. Wie sehr die neuen Nachbarn ihr eigenes Leben prägen würden, ahnte sie damals nicht.
Sie war ein junges Mädchen und an den Gerichtsprozess, der noch im selben Jahr vor dem Landgericht Aachen begann, erinnert sie sich kaum. Allein der Medienrummel, die vielen Fotografen und Kameraleute sind ihr im Gedächtnis geblieben. Mit ihren Eltern hat sie über das Urteil gesprochen. „Meine Mutter und mein Vater haben die Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln nie verstanden. Unsere Familie hatte mit der Wohngruppe kein Problem“, sagt sie.
Im Gegenteil: Wenn Vera Wilden an die Bewohner im Haus gegenüber zurückdenkt, fällt ihr als erstes Wilfried ein. „Er stand oft vor dem Haus auf dem Bürgersteig und hat sich gefreut, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kam“, erinnert sie sich und ergänzt: „Außerdem hat er diese Fähnchen von McDonald’s geliebt. Meine Schwester und ich haben ihm oft welche mitgebracht.“
Vera Wilden besuchte die Wohngruppe regelmäßig. Sie war mit der Tochter einer Betreuerin befreundet und die beiden Mädchen halfen beim Brote schmieren oder spielten mit den Bewohnern Ball. „Mir hat das immer viel Spaß gemacht“, sagt die Mutter eines Sohnes, die heute im Dürener Stadtteil Niederau lebt und sich sicher ist, dass die Erfahrungen in der Wohngruppe ihre spätere Berufswahl beeinflusst haben.
Denn die ausgebildete Heilerziehungspflegerin arbeitet heute als Betreuerin für die Rurtalwerkstätten, eine Einrichtung der Lebenshilfe Düren und Lebenshilfe Heilpädagogisches Zentrum zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben. Vera Wilden ist hier in einem speziellen Bereich für schwerst-mehrfachbehinderte Menschen tätig. „Ich habe mich ganz bewusst für diese Aufgabe entschieden, weil ich genau mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte“, sagt sie. Es geht darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung individuell zu fördern. Ihre vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten und auch neue zu trainieren. „Es ist so ein schönes Gefühl, wenn etwas funktioniert. Wenn einer unserer Mitarbeiter zum Beispiel plötzlich seinen Becher eigenständig halten kann“, erklärt sie.
Die 34-Jährige liebt ihre Arbeit, das ist nicht zu überhören. Ob sie sich ohne die Erfahrungen mit der Wohngruppe auch für diesen Beruf entschieden hätte, weiß natürlich niemand. Vera Wilden ist jedenfalls froh, dass die sieben schwer behinderten Männer 1993 in das Haus auf der anderen Straßenseite eingezogen sind.
Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Wohngruppe
Aus meiner Sicht war dieses Urteil niemals umsetzbar. Die Richter sprachen damals von „geeigneten Maßnahmen“, die wir als Mitarbeiter ergreifen sollten, damit keine Geräusche wie Schreien, Stöhnen, Kreischen oder sonstige unartikulierte Laute auf das Nachbargrundstück dringen. Was sollten das denn bitte für Maßnahmen sein? Sollten wir die Bewohner einsperren? Ich bin von dem Urteil auch heute noch geschockt und es ist nach wie vor ein Thema, wenn ich mit Kollegen von damals zusammenkomme.
Wie sind Sie und Ihre Kollegen in der Praxis mit dem Urteil umgegangen?
Zunächst haben wir tatsächlich versucht, uns an die vom Gericht vorgegebenen Zeiten zu halten. Auf Dauer ging das aber nicht. Man kann einem Menschen an einem schönen Sommertag nicht verbieten nach draußen zu gehen. Das wäre menschenunwürdig. Wir waren natürlich sensibilisiert und haben versucht, Rücksicht zu nehmen. Das haben wir aber auch schon vor dem Prozess getan.
Gab es nach dem Prozess noch Beschwerden von Seiten der Nachbarn?
Nicht das ich wüsste. Jedenfalls wurde vor Gericht keine neue Klage gegen die Wohngruppe eingereicht. Die Situation hat sich entspannt. Generell war es aber auch nicht so, dass alle Nachbarn der Wohngruppe kritisch gegenüberstanden. Ich kenne sogar eine junge Frau, die als Kind mit ihrer Familie in der Siedlung gelebt und später selbst einen Beruf in der Behindertenhilfe ergriffen hat. Sie hat die behinderten Menschen in ihrer Nachbarschaft also offensichtlich nicht als Störfaktor empfunden. Das macht doch Mut.
Das Urteil
Das Urteil
Das Urteil

„in der Jahreszeit zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober durch geeignete Maßnahmen zu verhindern, dass von den auf seinem Grundstück untergebrachten geistig behinderten Personen Lärmeinwirkungen wie Schreien, Stöhnen, Kreischen und sonstige unartikulierte Laute zu folgenden Tageszeiten auf das Grundstück des Klägers dringen:
a) an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ab 12:30 Uhr;
b) mittwochs und samstags ab 15:30 Uhr;
c) an den übrigen Werktagen ab 18:30 Uhr.“
Der LVR wertet das Urteil als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes. Unterstützt von vielen Sozialverbänden zieht er vor das Bundesverfassungsgericht. Doch die Karlsruher Richter lassen die Klage aus formalen Gründen nicht zu.

Urteilsbegründung
Die Urteilsbegründung
Die Urteilsbegründung
Lesen Sie hier einige Auszüge ...

„Aus dem Mißlingen der Sprechversuche resultieren Laute, die von einem unvoreingenommenen Zuhörer als unharmonisch, fehlmoduliert und damit als unangenehm empfunden werden.“
„Im Vordergrund der Beurteilung steht dabei weniger die Dauer und die Lautstärke als vielmehr die Art der Geräusche, denen der Kläger ausgesetzt ist.“
„Bei den Lauten, die die geistig schwerbehinderten Heimbewohner von sich geben, ist der „Lästigkeitsfaktor“ besonders hoch. So empfindet nach Auffassung des Senats nicht nur der „normale“ Durchschnittsmensch, der sich leicht von Vorurteilen leiten läßt, sondern auch der verständige Bürger (und Nachbar), dessen Haltung gegenüber Behinderten nicht von falschem Wertigkeitsdenken, sondern von Mitmenschlichkeit und Toleranz geprägt ist.“

2013
2014
Der LVR bietet genau diese Informationen in der „Themenwelt Arbeit“. Das LVR-Integrationsamt stellt seine Leistungen und Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber*innen sowie für Menschen mit Behinderung im Job vor. Wie die Praxis aussehen kann, präsentieren verschiedene Unternehmen der freien Wirtschaft, die erfolgreich Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigen.




















































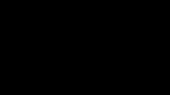






 20 Jahre Tag der Begegnung
20 Jahre Tag der Begegnung
 Wie alles begann ...
Wie alles begann ...
 1998
1998
 1998
1998
 1999
1999
 2000 / 2001
2000 / 2001
 2002
2002
 2003
2003
 2004
2004
 2005
2005
 2006
2006
 2007
2007
 2008 / 2009
2008 / 2009
 2010
2010
 2011
2011
 2012
2012
 2013 / 2014
2013 / 2014
 2015
2015
 2017
2017
 20. Tag der Begegnung
20. Tag der Begegnung
 Eine Frage zum Schluss
Eine Frage zum Schluss
 Porträt einer ehemaligen Nachbarin der Wohngruppe
Porträt einer ehemaligen Nachbarin der Wohngruppe
 Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Wohngruppe
Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter der Wohngruppe
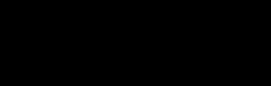 Das Urteil
Das Urteil
 2013
2013
 2014
2014
 2014
2014
 LVR-Bandcontest mit 2THEUNIVERSE und den Ottosingers
LVR-Bandcontest mit 2THEUNIVERSE und den Ottosingers
 LVR-Bandcontest mit 2THEUNIVERSE und den All Inclusives
LVR-Bandcontest mit 2THEUNIVERSE und den All Inclusives
 LVR-Bandcontest mit 2THEUNIVERSE und den PotiZeros
LVR-Bandcontest mit 2THEUNIVERSE und den PotiZeros